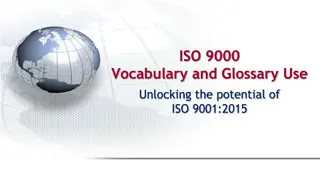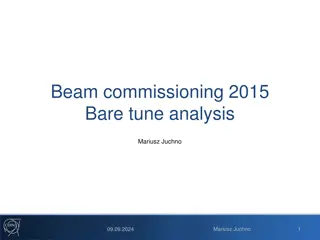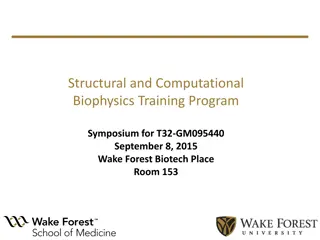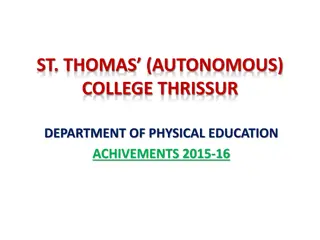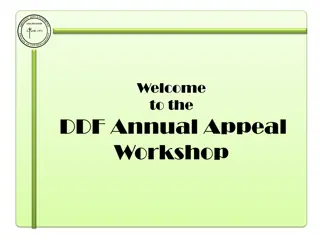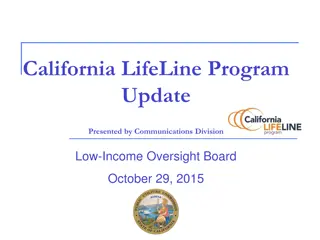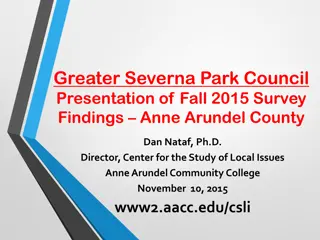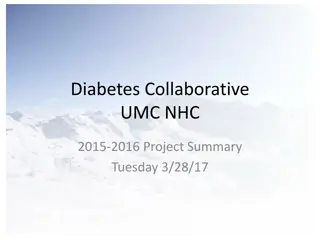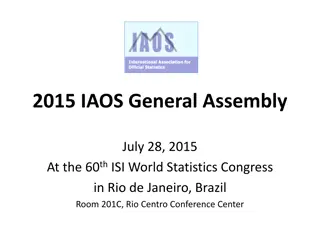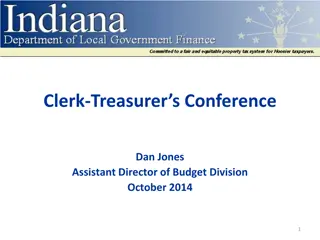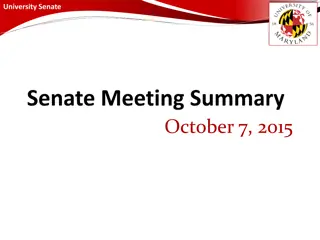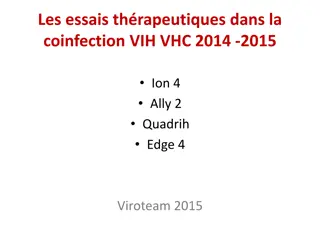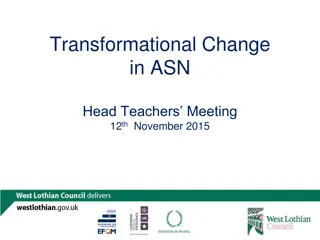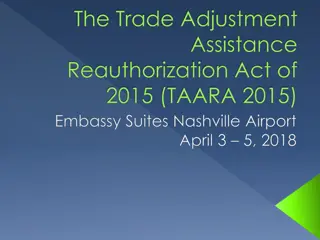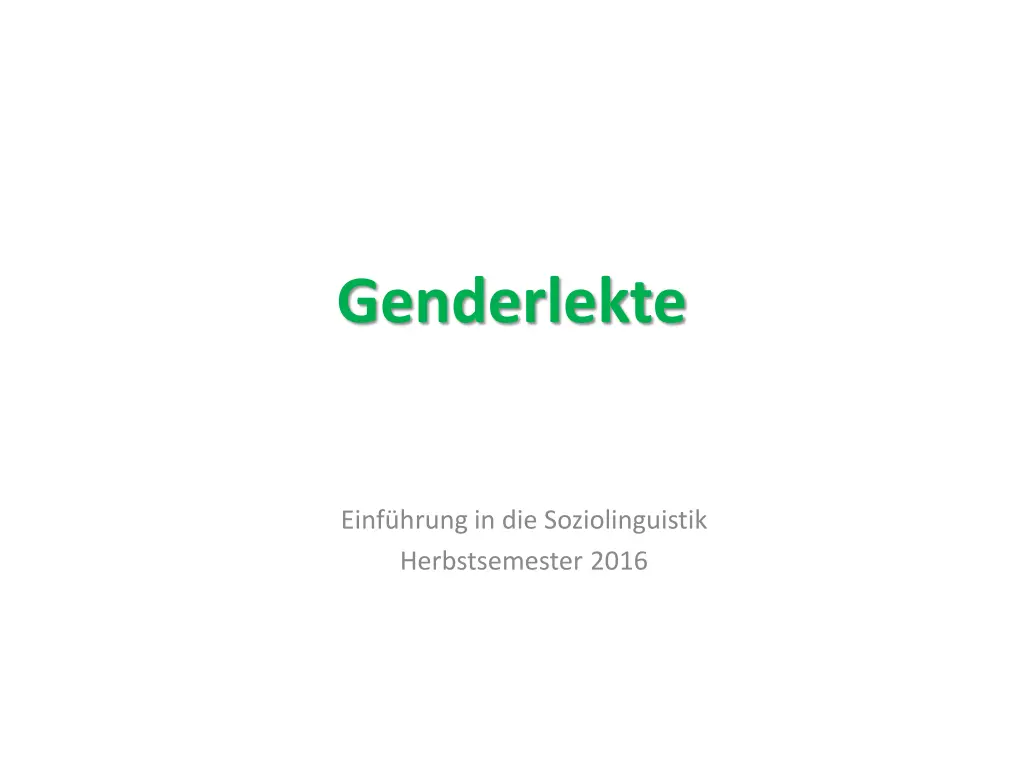
Exploring Genderlects in Sociolinguistics: A Look into Language and Gender Relations
Delve into the intriguing realm of genderlects, investigating how language reflects and perpetuates societal power structures and gender roles. Explore the linguistic nuances of gendered speech patterns and the impact of cultural expectations on spoken communication.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author. If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Genderlekte Einf hrung in die Soziolinguistik Herbstsemester 2016
Inhaltverzeichnis Begriff Anf nge der Untersuchungen Die 70er und 80er Jahre Zwei-Kulturen Theorie Gespr chskonflikte Besonderheiten im Sprachgebrauch
Einleitende Anmerkungen Beginn der Forschungen in den USA, anschlie end in Europa erste Beobachtungen der geschlechtspezifischen Unterschiede in der Ethnolinguistik, Dialektologie umstrittene Fragen, ob es systemische geschlechterrollenspezifische Unterschiede gibt, und ob sie verdienen, Variet t genannt zu werden
Begriff Genderlekte, Sexlekte, fm-Variet ten, linguistische Geschlechterforschung, geschlechtspezifische Sprechweisen, feministische Linguistik Genderlinguistik untersucht die Abh ngigkeit der Sprache vom sozialen Geschlecht Genderlekt ist ein hypothetisches Sprachsystem als Funktion des sozialen Geschlechts
Aufgaben Die die Gesellschaft kennzeichnenden Machtstrukturen, wie sie sich in der Sprache und im Kommunikationsverhalten widerspiegeln, aufzuzeigen die sprachlichen Besonderheiten der Geschlechtersprachen zu erforschen Ausgangspunkt: hierarchisch-patriarchalisches Geschlechterverh ltnis wird auf sprachlicher Ebene reproduziert
Untersuchungsgegenstnde Geschlechtspezifisches Sprachverhalten, das Resultat einer kulturspezifischen Rollenerwartung ist Stimmh he, Melodie, Lautst rke werden im soziolinguistischen Zusammenhang seltener untersucht Geschlecht als soziale Erscheinung oder soziales Geschlecht
Untersuchungen Begr nderinnen der feministischen Linguistik Robin Lakoff und Mary Richie Key bernahme der Idee in Deutschland durch Senta Tr mel-Pl tz Frauensprache im Mittelpunkt soziolinguistischer geschlechterbezogenen Untersuchungen jedoch keine Feststellung von einer allgemeinen Frauenvariet t alle anderen Variet ten als geschlechtsneutral oder als m nnlich
Hirnhemisphren Rechte Hemisph re: r umliches Denken W chst schneller bei M nner Sprache - eingeschr nkt Linke Hemisph re: Sprache und Kommunikation W chst schneller bei Frauen Sprache nicht eingeschr nkt
Sex(o)lekt vs. Genderlekt Sexus: biologische oder physiologische Unterscheidung von M nnern und Frauen Gender: soziale Identifizierung Im Deutschen: Geschlecht sowohl als biologisches oder physiologisches als auch soziales Merkmal
Anfnge der Untersuchungen Fritz Mauthner (1921) (Sprachphilosoph) Otto Jaspersen (1925)
Wilhelm von Humboldt (1835) Frauen dr cken sich in der Regel nat rlicher, zarter und dennoch kraftvoller, als M nner aus. Ihre Sprache ist ein treuerer Spiegel ihrer Gedanken und Gef hle [...]. Wirklich durch ihr Wesen n her an die Natur gekn pft, durch die wichtigsten und doch gew hnlichsten Ereignisse ihres Lebensin gr ere Gleichheit mit ihrem ganzen Geschlecht gestellt, [...] verfeinern und versch nern sie die Naturgem heit der Sprache, ohne ihr zu rauben, oder sie zu verletzen. Ihr Einfluss geht im Familienleben und im t glichen Umgang so unmerklich in das gemeinsame Leben ber, dass er sich einzeln nicht festhalten l sst.
Otto Jespersen (1925) Dar ber besteht jedoch kein Zweifel, dass die Frauen in allen L ndern davor zur ckschrecken, gewisse K rperteile und gewisse nat rliche Verrichtungen mit den unmittelbaren und oft derben Bezeichnungen zu benennen, die M nner und vor allem junge Leute bevorzugen, wenn sie unter sich sind. Die Frauen ersinnen deshalb harmlose und sch nf rbende W rter und Redensarten [...]
Die 70er und 80er Jahre Neue Frauenbewegungen in den USA Robin Lakoff, 1975: Language and Women s Place Mary Ritchie Key, 1975: Male/Female Language Helga Andersen, Gisela Klann u. a., 1978: Sprache und Geschlecht Ingrid Guentherodt u. a., 1980: Richtlinien zur Vermeidung sexistische Sprachgebrauchs
William Labov (1972) Frauen verwenden weniger stigmatisierte Formen Frauen entwickeln gegen ber soziolinguistischen Normen eine h here Sensibilit t als M nner Frauen verf gen ber eine gr ere sprachliche Variationsbreite als M nner
Peter Trudgill und Lesley Milroy (1974, 1987) Frauen bem hen sich aufgrund ihrer gegen ber M nnern sozio konomisch schwierigeren Situation um gr ere sprachliche Korrektheit Frauen orientieren sich mehr am sprachlichen Standard als M nner, sind aber sprachlich nicht konservativer
Robin Lakoff (1973) Frauen besitzen einen differenzierten Wortschatz im Bereich der Farbbezeichnungen Frauen verwenden schw chere Ausrufe, z. B. oh dear! (vs. m nnlich shit!), goodness! (vs. m nnlich damn!) Frauen verwenden Adjektive, die Assoziationen von Trivialit t erwecken, z. B. adorable, charming, lovely (vs. m nnlich oder neutral great, terrific, cool) Frauen stellen h ufig Fragen und verwenden angeh ngte Frageformen, z. B. Sure it is hot here, isn t it? Frauen neigen zur Verwendung von Unsch rfemarkierungen, z. B. you know, kind of Frauen dr cken sich h flicher aus als M nner
Friederike Braun und Ursula Pasero (1990er) Frauen orientieren sich in Aussprache und Grammatik an der hochsprachlichen Norm. Frauen sind h flicher und indirekter als M nner: sie kennzeichnen ihre u erungen z. B. h ufiger als Bitten. Frauen sprechen andere h ufig mit Namen an. Sie beziehen ihr Gegen ber aktiv in das Gespr ch ein. M nner sind in Gespr chen auf die Rolle des Sprechenden orientiert. Der Gespr chstil von Frauen ist kooperativer. Dagegen erscheint der Gespr chsstil von M nnern kompetitiv.
Deborah Tannen und John Gray (1990 und 1992) Frauen und M nner leben in verschiedenen Kulturen . Ihre Sprachen und kommunikativen Verhaltensweisen unterscheiden sich fundamental. Frauen und M nner sprechen unterschiedliche Genderlekte . Die unterschiedlichen Sprachen von Frauen und M nnern haben ihre Ursache schon im Kindesalter. Die unterschiedlichen Kommunikationsformen sind weder zu bewerten, noch zu berwinden.
Untersuchungsergebnisse Bisherige Untersuchungsergebnisse im Bereich der Frauensprache : Frauen mittleren Alters sprechen mehr Hochdeutsch oder eine standardn here Variet t Frauen mittleren Alters oder Frauen als M tter achten besonders auf die korrekte Sprache Frauen sind im Gebrauch des Formeninventars n her an der Standardnorm als M nner Frauen orientieren sich an prestigebesetzten Sprachgebrauchsweisen
Untersuchungsergebnisse im Schulalter sprechen und erz hlen M dchen besser als Jungen zur Beschreibung von T tigkeiten oder Vorg ngen verwenden Jungen mehr W rter und S tze als M dchen vermehrter Gebrauch von Unsicherheitsmarkierungen, R ckversicherungsfragen, empathischen Adjektiven, Euphemismen, Diminutiva, berh fliche, hyperkorrekte Sprachformen
Untersuchungsergebnisse seit den achtziger Jahren Diskussionen um geschlechtsneutrale Personenbezeichnungen Frauen neigen zum Code-Switching und k nnen von einem Code in einen anderen wechseln andere Merkmale des weiblichen Sprachgebrauchs wie etwa emotionaler Wortschatz, Kooperativit t, Konsensorientierung, Gespr chsarbeit sind eher nicht Frauen, sondern den westlichen Zivilisationen typisch
Frauen- und Mnnerstile FRAUENSTIL M NNERSTIL Unsicherheitsmarkierungen, R ckversicherungsfragen, empathische Adjektive, Euphemismen, Diminutiva, berh fliche, hyperkorrekte Sprachformen, kooperatives Gespr chsverhalten, Fragestellungen, Defizithypothese Unterbrechungen und Unterbrechungsversuche Steuerung des Gespr chsthemas, l ngere Redezeit, verz gerte oder ausbleibende H rerr ckmeldungen, Differenzhypothese
Gesprchskonflikte KRITIK: Mechanisches Z hlen von Unterbrechungen Funktion der Unterbrechungen: kooperativ / kompetitiv
Geschlechterspezifische Aussprachevarianten im Russischen Laut Musterwort Ergebnisse goluboj /alu/ (unbet.) /oj/ (bet.) Frauen sprechen beide Vokalgruppen im Durchschnitt l nger als M nner Frauen sprechen beide Laute l nger als M nner und damit das ganze Wort (ca. eine zehntel Sekunde) Frauen sprechen Wochentage im Durchschnitt langsamer aus als M nner tapo ki /a/ (unbet.) /a/ (bet.) Wochentage (Studie von Strewe 1993)
Geschlechterspezifische Aussprachevarianten im Russischen Laut Musterwort Ergebnisse / / etyre, etverg, ernyj, tapo ki, sej as, no goluboj Frauen sprechen 1. st rker affriziert, 2. normorientierter als M nner. /u/ wird von M nnern 1. st rker zu Null reduziert als von Frauen, 2. seltener gerundet gesprochen Frauen bevorzugen 1. nasale Aussprache des /n/, 2.vordere Aussprache /a/ M nner bevorzugen 1. nicht nasale Aussprache des /n/ 2. hintere Aussprache des /a/ /a/ (unbet.) /u/ (unbet.) oran evyj /an/ (Studie von Strewe 1993)
Ergebnisse der russischen Genderlekt- Forschung nach Potapova/Potapov 2006 Frauen sprechen betontes [o] und [ ] st rker diphtongisiert aus: Nas v sanat[uo]rijotpravljajut. Frauen verwenden mehr Aspiration, Labialisation und Nasalisation zur emotionalen Markierung. Frauen markieren Expressivit t st rker durch Prosodie als M nner. M nner verwenden zur expressiven Markierung st rker lexikalische Mittel als Frauen.
Untersuchung bei der Fernsehdiskussion (Ulrike Gr el, 1991) Best tigt werden konnte nicht, dass M nner mehr Redezeit beanspruchen, mehr Redebeitr ge liefern, mehr unterbrechen, h ufiger selbst das Wort ergreifen und Frauen wiederum nicht mehr Bez ge herstellen, h ufiger ihre Gespr chspartner ansprechen und mehr R ckversicherungsfragen stellen. Best tigt werden konnten die Thesen, dass Frauen mehr Unterst tzungen geben (insbesondere Minimalreaktionen), h ufiger die S tze anderer Personen vollenden (H reraktivit t), h ufiger als M nner Fragen statt Aussagen formulieren und M nner demgegen ber h ufiger die eher dominante Geste des erhobenen Zeigefingers verwenden, w hrend Frauen im Bereich der Mimik h ufiger ein abschw chendes L cheln zeigen.
Untersuchung bei der Fernsehdiskussion (Helga Kotthoff, 1992) In der m nnlich dominierten Debatte entsteht ein Gef lle zwischen Experten und Laien (nicht Gelehrten), was in der weiblich dominierten Diskussion so gut wie keine Rolle spielt. Auch in der weiblich dominierten Gespr chsrunde ist der m nnliche Gespr chsstil berlegen, d.h. auch geladene Expertinnen lassen sich in den Hintergrund dr ngen.
Untersuchung im Hochschulbereich (Elisabeth Kuhn 1992) Frauen formulieren Seminarplananordnungen vorsichtiger. Frauen neigen eher dazu, Aufforderungen abzuschw chen. Sowohl Professorinnen als auch Professoren setzen die Erw hnung der Institution bei der Formulierung ihrer Anforderungen ein, wobei M nner eher darstellen, dass sie selbst f r die Anforderungen verantwortlich sind und Frauen das Ziel haben, durch die Erw hnung der Institution weniger autorit r zu erscheinen.
Untersuchung im Hochschulbereich (Susanne G nthner, 1992) Auch die kulturelle Zugeh rigkeit beeinflusst das Sprachverhalten. Deutsche Dozentinnen weisen mehr Konfrontationsbereitschaft auf, w hrend die chinesischen Studentinnen sich indirekter ausdr cken Das Status- und Machtgef lle sowie die Asymmetrie hinsichtlich der Sprachkompetenz spiegeln sich ebenfalls im Sprachverhalten wider Es zeigen sich Unterschiede im Sprachverhalten zwischen den chinesischen Studentenund Studentinnen. Chinesinnen bem hen sich mehr um Kompromisse als Chinesen.
Exkurs: Es fngt in der Kindheit an Mit M dchen und Jungen wird anders gesprochen Es werden unterschiedliche Antworten erwartet Freizeit in gleichgeschlechtlichen Spielgruppen Geschlechtsspezifische Sprechweisen schon bei Dreij hrigen
Untersuchungen von Kindern (Amy Sheldon) M dchen- und Jungengruppen im Alter von 3-4 Jahren Unterschiedliche Strategien der Konfliktl sung M dchen versuchen den Konflikt abzuschw chen
Untersuchungen von Kindern Jungen spielen in gr eren, hierarchisch strukturierten Gruppen zusammen Die Spiele der Jungen haben meistens Gewinner und Verlierer Jungen prahlen oft mit ihren F higkeiten und streiten miteinander
Untersuchungen von Kindern M dchen spielen meistens in kleineren Gruppen, oder zu zweit Im Mittelpunkt des sozialen Lebens steht die beste Freundin Bei den Spielen der M dchen gibt es h ufig keine Gewinnerin oder Verliererin M dchen prahlen nicht mit ihren F higkeiten
Untersuchungen von Kindern (Jaqueline Sachs) Jungen werden auf sp teres Berufsleben vorbereitet Von ihnen wird erwartet, ihre Interessen durch den Gebrauch strikterer Sprache zu vertreten M dchen hingegen werden auf ihre sp tere Familienwelt vorbereitet M dchen neigen dazu, ihre Vorschl ge mit Formulierungen wie "Lasst uns...", "Wollen wir nicht..." einzuleiten, w hrend Jungen sich h ufig Befehle erteilen
Ein Beispiel aus dem Sketch Garderobe M: Ich finde, du siehst toll aus in dem, was du anhast. F: Komplimente helfen mir im Moment berhaupt nicht. M: Gut, dann zieh das lange blaue mit den Sch chen an. F: Du findest also gar nicht so toll, was ich anhabe! M: Doch, aber es gef llt dir ja scheinbar nicht. F: Es gef llt mir nicht? Es ist das sch nste, was ich habe. M: Dann behalt es doch an. F: Eben hast du gesagt, ich soll das lange blaue mit den Sch chen anziehen. M: Du kannst das blaue mit den Sch chen anziehen oder das gr ne mit dem spitzen Ausschnitt oder das, was du anhast. F: Aha, es ist dir also v llig Wurst, was ich anhabe.
Fazit Geschlechtspezifische Sprachunterschiede sind bisher nicht eindeutig nachgewiesen worden die Geschlechter weisen keine eigenst ndigen linguistischen Merkmale auf Abh ngigkeit von anderen Faktoren wie Alter, Situation, Kontext, Umgebung, Hautfarbe, Sozialstatus, Ausbildung, Thema die Geschlechter verfolgen unterschiedliche Konversationsstile
Fazit Zuverl ssige Aussagen ber den Einfluss des Geschlechts sind nur dann m glich, wenn es gelingt, alle andere Einflussfaktoren bei der Analyse auszuschlie en. Das ist aber kaum m glich
Literatur und Quellen Vortrag erarbeitet nach der Pr sentation von Asta Vitukynait und Emilija ilinskait und nach der Pr sentation von Daumantas Katinas, Einf hrung in die Soziolinguistik, Herbstsemester 2013 Humboldt, W., ber die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues. In: Werke. Bd. 3. Stuttgart 1963, S. 253 Jespersen, O.: Die Sprache. Ihre Natur, Entwicklung und Entstehung. Heidelberg 1925, S. 229 Lesley Milroy 1987. Language an d Social Networks. London: Blackwell Lakoff R., 1973: Language and woman s place. In: Language in Society 2, S. 45 80 Dittmar, N., 1997: Grundlagen der Soziolinguistik: Ein Arbeitsbuch mit Aufgaben. T bingen. L ffler, H. 2005: Germanistische Soziolinguistik. Berlin. Thaler, V. 2005: Sprechen Frauen tats chlich anders als M nner? In: Grazer Linguistische Studien 63. Graz. Peter Trudgill 1974: The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: University Press Werner H. Veith Soziolinguitik. Ein Arbeitsbuch , T bingen 2002 http://tu- dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/fakultaet_sprach_literatur_und_kulturwissenschaften/s lavistik/studium/unterrichtsmat/ss%2008/vorl_kultwiling_gender4.pdf (Stand: 12.10.2013)