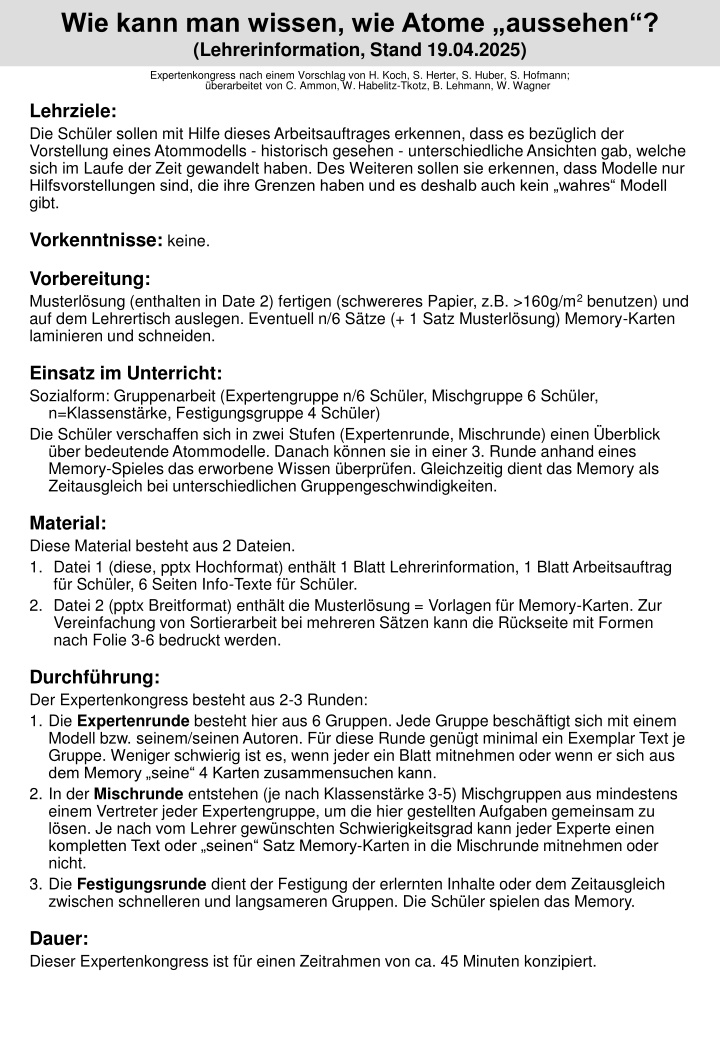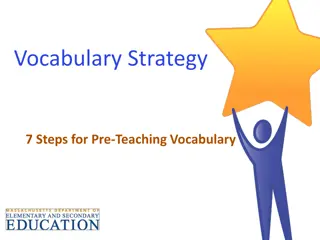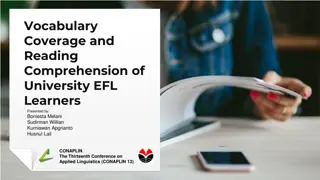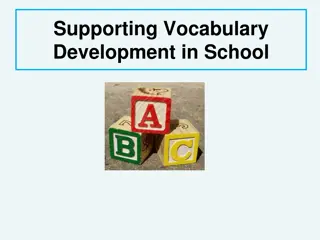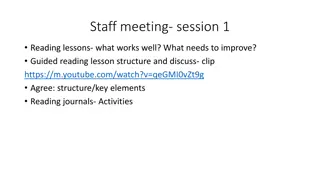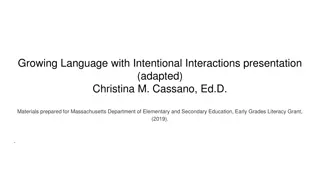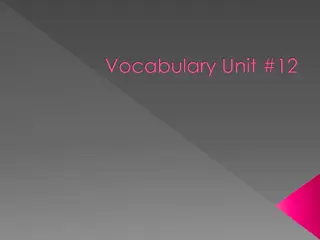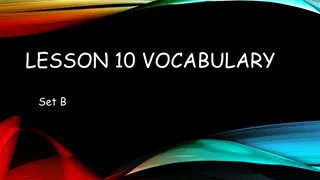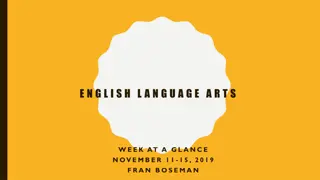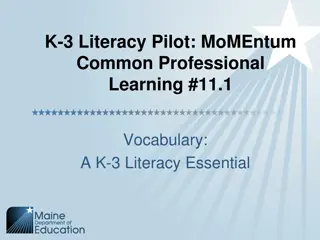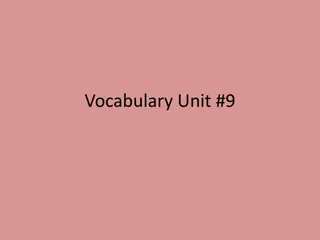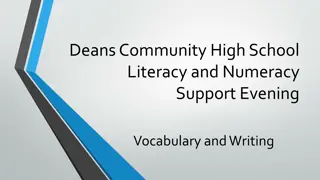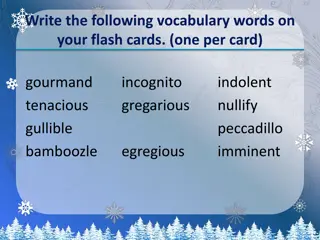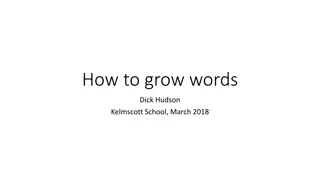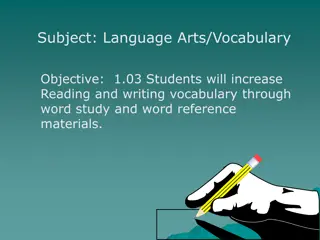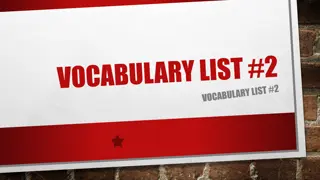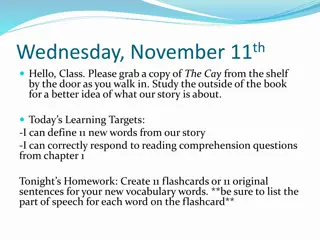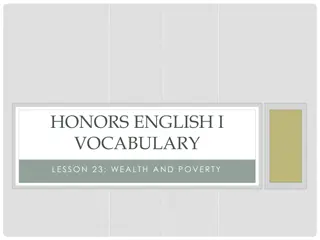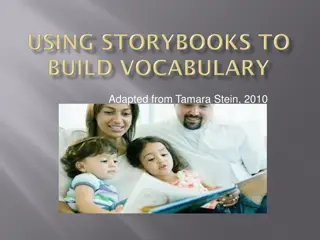Vocabulary Set B Definitions and Examples
Learn the meanings of various words such as accelerate, casual, entice, flounder, graphic, parch, puny, ratify, regal, and stifle with corresponding examples. Enhance your vocabulary skills with this set of descriptive definitions and images.
Download Presentation

Please find below an Image/Link to download the presentation.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.If you encounter any issues during the download, it is possible that the publisher has removed the file from their server.
You are allowed to download the files provided on this website for personal or commercial use, subject to the condition that they are used lawfully. All files are the property of their respective owners.
The content on the website is provided AS IS for your information and personal use only. It may not be sold, licensed, or shared on other websites without obtaining consent from the author.
E N D
Presentation Transcript
Wie kann man wissen, wie Atome aussehen? (Lehrerinformation, Stand 19.04.2025) Expertenkongress nach einem Vorschlag von H. Koch, S. Herter, S. Huber, S. Hofmann; berarbeitet von C. Ammon, W. Habelitz-Tkotz, B. Lehmann, W. Wagner Lehrziele: Die Sch ler sollen mit Hilfe dieses Arbeitsauftrages erkennen, dass es bez glich der Vorstellung eines Atommodells - historisch gesehen - unterschiedliche Ansichten gab, welche sich im Laufe der Zeit gewandelt haben. Des Weiteren sollen sie erkennen, dass Modelle nur Hilfsvorstellungen sind, die ihre Grenzen haben und es deshalb auch kein wahres Modell gibt. Vorkenntnisse: keine. Vorbereitung: Musterl sung (enthalten in Date 2) fertigen (schwereres Papier, z.B. >160g/m2 benutzen) und auf dem Lehrertisch auslegen. Eventuell n/6 S tze (+ 1 Satz Musterl sung) Memory-Karten laminieren und schneiden. Einsatz im Unterricht: Sozialform: Gruppenarbeit (Expertengruppe n/6 Sch ler, Mischgruppe 6 Sch ler, n=Klassenst rke, Festigungsgruppe 4 Sch ler) Die Sch ler verschaffen sich in zwei Stufen (Expertenrunde, Mischrunde) einen berblick ber bedeutende Atommodelle. Danach k nnen sie in einer 3. Runde anhand eines Memory-Spieles das erworbene Wissen berpr fen. Gleichzeitig dient das Memory als Zeitausgleich bei unterschiedlichen Gruppengeschwindigkeiten. Material: Diese Material besteht aus 2 Dateien. 1. Datei 1 (diese, pptx Hochformat) enth lt 1 Blatt Lehrerinformation, 1 Blatt Arbeitsauftrag f r Sch ler, 6 Seiten Info-Texte f r Sch ler. 2. Datei 2 (pptx Breitformat) enth lt die Musterl sung = Vorlagen f r Memory-Karten. Zur Vereinfachung von Sortierarbeit bei mehreren S tzen kann die R ckseite mit Formen nach Folie 3-6 bedruckt werden. Durchf hrung: Der Expertenkongress besteht aus 2-3 Runden: 1. Die Expertenrunde besteht hier aus 6 Gruppen. Jede Gruppe besch ftigt sich mit einem Modell bzw. seinem/seinen Autoren. F r diese Runde gen gt minimal ein Exemplar Text je Gruppe. Weniger schwierig ist es, wenn jeder ein Blatt mitnehmen oder wenn er sich aus dem Memory seine 4 Karten zusammensuchen kann. 2. In der Mischrunde entstehen (je nach Klassenst rke 3-5) Mischgruppen aus mindestens einem Vertreter jeder Expertengruppe, um die hier gestellten Aufgaben gemeinsam zu l sen. Je nach vom Lehrer gew nschten Schwierigkeitsgrad kann jeder Experte einen kompletten Text oder seinen Satz Memory-Karten in die Mischrunde mitnehmen oder nicht. 3. Die Festigungsrunde dient der Festigung der erlernten Inhalte oder dem Zeitausgleich zwischen schnelleren und langsameren Gruppen. Die Sch ler spielen das Memory. Dauer: Dieser Expertenkongress ist f r einen Zeitrahmen von ca. 45 Minuten konzipiert.
Atommodelle (Arbeitsauftrag) 1. Expertenrunde: Jeder von euch liest sich einen Text genau durch (Texte 6a und 6b geh ren zusammen) und bespricht ihn gegebenenfalls in der Runde der Experten. 2. Mischrunde: (Schneidet das unsortierte Memory sauber aus bzw. ihr bekommt vom Lehrer fertige Memory-Karten.) Legt die Bilder der Wissenschaftler anschlie end untereinander in chronologischer Reihenfolge auf. Aufgabe dann: der jeweilige Experte ordnet jedem Bild die anderen drei K rtchen (Name, Modellvorstellung, Modellgrenzen) zu, indem er sie neben das Bild legt. Vergleicht euer Ergebnis mit der Musterl sung auf dem Lehrertisch und pr gt euch die Zusammenh nge ein. 3. Spielrunde (zur Festigung): Nun verwendet ihr die Karten als Memory und sammelt Paare (z.B. Name und Modellvorstellung). Wer am Schluss die meisten Paare gesammelt hat, ist Sieger. Atommodelle (Arbeitsauftrag) 1. Expertenrunde: Jeder von euch liest sich einen Text genau durch (Texte 6a und 6b geh ren zusammen) und bespricht ihn gegebenenfalls in der Runde der Experten. 2. Mischrunde: (Schneidet das unsortierte Memory sauber aus bzw. ihr bekommt vom Lehrer fertige Memory-Karten.) Legt die Bilder der Wissenschaftler anschlie end untereinander in chronologischer Reihenfolge auf. Aufgabe dann: der jeweilige Experte ordnet jedem Bild die anderen drei K rtchen (Name, Modellvorstellung, Modellgrenzen) zu, indem er sie neben das Bild legt. Vergleicht euer Ergebnis mit der Musterl sung auf dem Lehrertisch und pr gt euch die Zusammenh nge ein. 3. Spielrunde (zur Festigung): Nun verwendet ihr die Karten als Memory und sammelt Paare (z.B. Name und Modellvorstellung). Wer am Schluss die meisten Paare gesammelt hat, ist Sieger.
Demokrit (Text 1) um 460 bis ca. 370 v. Chr. ein griechischer Philosoph aus Abdera (Thrakien), der die von seinem Lehrer Leukipp begr ndete Lehre vom Atomismus weiterentwickelte. In Demokrits Vorstellung bestehen alle Dinge aus unsichtbaren und unzerst rbaren Materieteilchen, Atome genannt, (griechisch atoma: unteilbar), die sich ewig im endlosen leeren Raum bewegen. Dieser leere Raum existiert, ohne selbst aus Atomen zu bestehen. Obwohl sie exakt aus dem gleichen Stoff bestehen, unterscheiden sich die Atome nach Gr e, Lage und Form. Ihre Eigenschaft, sich mit anderen Atomen zu verbinden, erzeugt die gegenst ndliche Welt. Die Eigenschaften der Gegenst nde wiederum werden allein bestimmt vom Zusammenhalt dieser kleinsten Materieteilchen. Die Entstehung der Welt ist nach Demokrit dementsprechend eine Folge der unabl ssigen Bewegung der Atome im Raum. Demokrit verfasste auch Schriften zur Ethik, in denen er Gl ckseligkeit durch Wohlbefinden (griechisch euest ) der Seele als h chstes Gut pries. Deshalb bekam er den Beinamen Der lachende Philosoph . Grenzen des Modells: Der Unterschied zwischen Stoffgemisch und chemischer Verbindung ist noch nicht gesichert. Au erdem sind Atome nicht unteilbar.
Aristoteles (Text 2) 384-322 v. Chr. Zusammen mit Platon und Sokrates geh rt er zu den ber hmtesten und bedeutendsten Philosophen des Altertums. Mit seinen Lehren wurde er zu einem zentralen Denker der abendl ndischen Philosophie. Sein Leben: Aristoteles wurde in Stagira in Makedonien geboren und zog im Alter von 17 Jahren nach Athen, um an Platons Akademie zu studieren. Dort blieb er etwa 20 Jahre lang, anfangs als Student und dann als Lehrer. Nach Platons Tod 347 v. Chr. zog Aristoteles nach Assos, einer Stadt in Kleinasien. Dort herrschte Hermias, mit dem er befreundet war. Nachdem Hermias 345 v. Chr. von den Persern gefangen genommen und get tet wurde, zog Aristoteles nach Pella, der Hauptstadt Makedoniens. Dort war er Erzieher des Thronfolgers, des sp teren Alexander des Gro en. Als Alexander 335 v. Chr. K nig wurde, kehrte Aristoteles nach Athen zur ck und gr ndete seine eigene Schule, das Lykeion. Da die Gespr che zwischen Sch lern und Lehrern h ufig w hrend Spazierg ngen auf dem Schulgel nde des Lykeion stattfanden, wurde Aristoteles Schule als Wandelschule bekannt. Nach Alexanders Tod 323 v. Chr. verbreitete sich in Athen eine starke anti-makedonische Gesinnung, und Aristoteles zog sich auf sein Landgut auf Eub a zur ck, wo er ein Jahr sp ter starb. Seine Lehre: Aristoteles geht von einem endlichen, sph rischen Universum aus, in dessen Mittelpunkt sich die Erde befindet. Der zentrale Bereich besteht aus den vier Elementen: Erde, Luft, Feuer und Wasser. In Aristoteles Lehre ist jedem dieser vier Elemente ein genauer Platz angewiesen. Jedes der Elemente bewegt sich in seiner nat rlichen geradlinigen Bahn seinem eigentlichen Ruhepunkt entgegen. Daraus ergibt sich, dass irdische Bewegungen immer geradlinig sind und immer zum Stillstand kommen. Die Himmel jedoch bewegen sich nat rlich und ewig in einer komplexen, kreisf rmigen Bewegung, was ein f nftes, neues Element erforderlich macht, das Aristoteles Aither ( ther) nennt. Als h heres Element ist Aither unver nderlich und kann blo seinen Platz in kreisf rmigen Bewegungen ver ndern. Grenzen des Modells: Hier k nnen chemische Reaktionen und die Vielfalt der Stoffe noch nicht erkl rt werden.
John Dalton (Text 3) 1766-1844 britischer Chemiker und Physiker, entwickelte die Atomtheorie, auf der die moderne physikalische Wissenschaft beruht. Sein Leben: Dalton wurde am 6. September 1766 in Eaglesfield (Cumberland, heute Cumbria) als Sohn eines Webers geboren. Unterricht erhielt er von seinem Vater und an einer Qu kerschule in seiner Heimatstadt, wo er schon mit zw lf Jahren zu lehren begann. 1781 zog er nach Kendal und leitete dort mit seinem Cousin und dem lteren Bruder eine Schule. Er ging 1793 nach Manchester und verbrachte dort den Rest seines Lebens als Lehrer zuerst am New College und sp ter als Privatgelehrter. Er starb am 27. Juli 1844 in Manchester. Sein Werk: Nach Daltons Atomhypothese bestehen alle Elemente aus winzig kleinen, unver nderlichen und unteilbaren Teilchen, den Atomen. Er ging dabei von einer begrenzten Anzahl unterschiedlicher Atomarten aus und vermutete, dass sich verschiedene Atome zu gro en Verb nden zusammenschlie en und sich dabei vielf ltig kombinieren lassen. Diese aus Atomen zusammengesetzten Teilchen nennen wir heute Molek le. Daltons bedeutendster Beitrag zur Wissenschaft war seine Theorie, dass die Materie aus Atomen verschiedener Gewichte besteht, die sich in bestimmten, einfachen Teilchenanzahlverh ltnissen miteinander verbinden. Diese Theorie, die Dalton 1803 erstmalig vorstellte, stellt einen Grundpfeiler der modernen Physik dar. Sie wurde unter dem Namen Gesetz der multiplen Proportionen bekannt. 1808 ver ffentlichte Dalton sein Buch A New System of Chemical Philosophy (Ein neues System des chemischen Theiles der Naturwissenschaft). Darin hatte er die Atomgewichte einer Reihe bekannter Elemente im Verh ltnis zum Gewicht von Wasserstoff (das er gleich eins setzte) angef hrt. Seine Gewichte waren noch nicht exakt, bildeten aber die Grundlage f r das moderne Periodensystem der chemischen Elemente. Grenzen des Modells: Mit Hilfe dieses Modells kann die Bildung von Ionen nicht erkl rt werden. Folglich k nnen auch chemische Bindungen nicht verstanden werden.
Ernest Rutherford (Text 4) Lord of Nelson and Cambridge 1871-1937 britischer Physiker, der f r seine bahnbrechende Arbeit in der Kernphysik und f r seine Theorie zur Atomstruktur den Nobelpreis erhielt. Leben und Werk: Rutherford wurde bei Nelson (Neuseeland) geboren und studierte an den Universit ten von Neuseeland und Cambridge. Er war von 1898 bis 1919 Professor f r Physik an der Universit t in Montreal (Kanada) und w hrend der n chsten zw lf Jahre an der Universit t von Manchester (England). Nach 1919 arbeitete Rutherford als Professor f r Experimentalphysik und Direktor des Cavendish Laboratory der Universit t von Cambridge und hatte nach 1920 auch einen Lehrstuhl an der Royal Institution of Great Britain in London. Rutherford z hlt zu den ersten und bedeutendsten Forschern in der Kernphysik. Schon bald nach der Entdeckung der Radioaktivit t (1896 durch den franz sischen Physiker Antoine Henri Becquerel) identifizierte Rutherford die drei Hauptbestandteile der Strahlung und nannte sie Alpha-, Beta- und Gammastrahlen. Er wies au erdem nach, dass die Alphateilchen Atomkerne des Heliums sind. Ber hmt ist Rutherford durch seinen genialen Streuversuch geworden: Er schoss mit winzigen alpha-Teilchen auf eine d nne Goldfolie. Dabei stellte er fest, dass fast alle diese Goldfolie ungehindert durchdrangen, nur wenige Teilchen wurden abgelenkt oder sogar zur ckgeworfen. Daraus schloss er, dass die Goldatome aus nahezu leeren R umen bestehen und stellte seine Theorie der Atomstruktur auf, in der das Atom erstmalig als winziger, dichter Kern mit ihn umkreisenden Elektronen beschrieben wurde. Im Jahr 1919 gelang Rutherford ein weiteres wichtiges Experiment: Durch den Beschuss von Stickstoff mit Alphastrahlen wurden die Atome eines Sauerstoffisotops sowie Protonen freigesetzt. Mit dieser Umwandlung von Stickstoff- in Sauerstoffatome war die erste k nstliche Kernreaktion vollzogen. 1914 wurde Rutherford zum Ritter geschlagen und 1931 zum Lord ernannt. Er starb in London und wurde dort in der Westminster Abbey beigesetzt. Grenzen des Modells: Nach diesem Atommodell kreisen die Elektronen auf beliebigen Bahnen um den Atomkern und m ssten theoretisch nach ca. 10-16 Sekunden in den Kern st rzen. Dies trifft aber in der Realit t nicht zu. Weiterhin m sste ein Atom, wenn es durch Energiezufuhr angeregt ist, ein kontinuierliches Lichtspektrum abgeben, allerdings treten in Wirklichkeit f r jedes Element ganz charakteristische Spektrallinien auf.
Niels Bohr (Text 5) 1885-1962 d nischer Physiker und Nobelpreistr ger, der u. a. wichtige und grundlegende Beitr ge zur Kernphysik sowie zum Verst ndnis des Aufbaus der Atome lieferte. Sein Leben: Bohr war der Sohn eines Professors und wurde in Kopenhagen geboren. Er studierte an der Universit t Kopenhagen und erlangte dort im Jahr 1911 seine Doktorw rde. Noch im gleichen Jahr ging Bohr an die Universit t Cambridge in England, um Kernphysik zu studieren. Bald darauf begab er sich an die Universit t Manchester, um mit Ernest Rutherford zusammenzuarbeiten. Sein Werk: Bohrs Theorie zum Aufbau der Atome war vom Rutherfordschen Atommodell abgeleitet, bei dem die Elektronen den Atomkern umkreisen wie die Planeten die Sonne . Seine Untersuchungen ber die Struktur der Atomh lle f hrten zu der Erkenntnis, dass die Elektronen den Atomkern nicht ungeordnet umkreisen, sondern gesetzm ig auf bestimmte Umlaufbahnen verteilt sind. Diese Umlaufbahnen um den Atomkern werden Elektronenschalen genannt. Die maximal sieben Elektronenschalen bezeichnet man von innen nach au en mit Nummern (1 7). Die u ere Schale nennt man Au enschale (Valenzschale) und ihr kommt eine besondere Bedeutung zu. Bohr erkannte auch, dass die Zahl der Elektronen, die in einer Schale Platz finden, begrenzt ist und jede Elektronenschale nur eine bestimmte H chstzahl an Elektronen aufnehmen kann. Diese maximale Elektronenzahl einer Energiestufe kann durch die Formel 2n2 ausgedr ckt werden, wobei n die Periodennummer ist. Die Au enschale eines Atoms kann immer nur h chstens acht Elektronen aufnehmen. Sie werden als Au enelektronen (Valenzelektronen) bezeichnet und legen die chemischen Eigenschaften eines Elements fest. F r seine Arbeiten erhielt der Wissenschaftler 1922 den Nobelpreis f r Physik. Grenzen des Modells: Das Modell erkl rt richtig die aus den Experimenten folgenden Spektrallinien des Wasserstoffatoms und wasserstoff hnlicher Ionen. Es gestattet allerdings keine Erkl rung f r die unterschiedlichen Intensit ten der Spektrallinien. Au erdem kann man die Aufspaltung der Spektrallinien in eng benachbarte Linien nicht erkl ren.
Werner Heisenberg (Text 6a) 1901-1976 deutscher Physiker und Nobelpreistr ger, einer der Begr nder der Quantenmechanik, Beitr ge zur Theorie der Atomstruktur (Heisenbergsche Unsch rferelation). Sein Leben: Heisenberg wurde in W rzburg geboren und studierte mathematische Physik, Mathematik und Astronomie an der Universit t M nchen. 1923 habilitierte er sich bei Max Born an der Universit t G ttingen. Sein Werk: Von 1924 bis 1927 hielt er sich zu Forschungszwecken bei dem d nischen Physiker Niels Bohr an der Universit t Kopenhagen auf. 1927 wurde Heisenberg als Professor f r Theoretische Physik an die Universit t Leipzig berufen. Anschlie end wirkte er als Professor an der Universit t Berlin (1941- 1945). 1941 wurde er Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts f r Physik (1948 in Max-Planck-Institut f r Physik umbenannt). Von 1946 bis zu seinem Tod 1976 leitete er das Max-Planck-Institut in G ttingen, welches 1958 nach M nchen verlegt und um die Institute f r Physik und Astrophysik erweitert wurde. W hrend des 2. Weltkrieges war Heisenberg f r die wissenschaftliche Forschung in Zusammenhang mit dem deutschen Kernenergieprojekt verantwortlich. Nach dem Krieg war er kurze Zeit in England interniert. Er war einer der bedeutendsten theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts, der die Physik und die Philosophie nachhaltig beeinflusste. Seine wichtigsten Beitr ge leistete er zur Theorie der Atomstruktur. 1925 begann er mit der Entwicklung einer besonderen Form der Quantenmechanik. Die darin enthaltene mathematische Formulierung basiert auf der Strahlung, die das Atom absorbiert und emittiert sowie auf den Energieniveaus des atomaren Systems. Heisenbergs Unsch rferelation spielte eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Mechanik und bte gro en Einfluss auf die moderne Philosophie aus. Sie besagt, dass man f r kein Teilchen gleichzeitig den Impuls und den Ort bestimmen kann. 1933 wurde Heisenberg der Nobelpreis f r Physik verliehen. Er starb am 1. Februar 1976 in M nchen.
Erwin Schrdinger (Text 6b) 1887-1961 sterreichischer Physiker und Nobelpreistr ger, weltbekannt durch seine mathematischen Studien zur Wellenmechanik. Sein Leben: Schr dinger wurde in Wien geboren und studierte an der dortigen Universit t. Er lehrte Physik an den Universit ten von Stuttgart, Breslau, Z rich, Berlin, Oxford und Graz. An der Schule f r Theoretische Physik des Institute of Advanced Study in Dublin war er von 1940 bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1955 Direktor. Sein Werk: Schr dingers bedeutendster Beitrag zur Physik lag in der Entwicklung der nach ihm benannten Gleichung. Es handelt sich dabei um eine nicht-relativistische Bewegungsgleichung f r ein quantenmechanisches System. Schr dinger bewies die mathematische quivalenz zwischen seiner 1926 ver ffentlichten Theorie und der Matrizenmechanik des deutschen Physikers Werner Heisenberg, die dieser im vorhergehenden Jahr entwickelt hatte. Die Theorien der beiden Wissenschaftler bildeten zusammen einen wesentlichen Teil der Grundlagen f r die Quantenmechanik. Schr dinger teilte sich 1933 den Nobelpreis f r Physik mit dem britischen Physiker Paul Adrien Maurice Dirac f r seinen Beitrag zur Entwicklung der Quantenmechanik. Seine Forschungen bereicherten auch das Wissen ber Atomspektren, statistische Thermodynamik und Wellenmechanik. Abschlie ende Bemerkung: Vermutlich ist das Modell nach Heisenberg und Schr dinger auch nicht das letzte Atommodell. Daher ist es auch nicht das wahre Modell, denn jedes Modell ist nur eine Hilfsvorstellung, die ihre Grenzen hat. Physiker w nschen sich eine gemeinsame Theorie von Quantenmechanik und Gravitation, die aber bisher noch nicht gefunden ist.